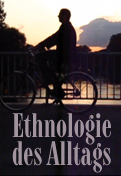 Gegen Mittag werde ich von einer leisen Unruhe gemahnt, ich müsse hinaus und mich draußen bewegen. Ich öffne mehrmals ein Fenster und schaue hinaus. Der Wind, der an der Front der Häuser von Westen vorbeistreicht, trügt. Es ist, als ich vor die Tür trete, heiß und drückend. Trotzdem schreite ich aus, auf der Schattenseite den Kötnerholzweg hinunter, biege in die Velberstraße ein, überquere die belebte Limmerstraße und gehe weiter über die Leinaustraße zum Kulturzentrum Faust. Es findet auf dem Gelände allsonntäglich ein Flohmarkt statt. Einige Händler bauen schon ihre Stände ab. Meinetwegen! Ich will sowieso nichts kaufen.
Gegen Mittag werde ich von einer leisen Unruhe gemahnt, ich müsse hinaus und mich draußen bewegen. Ich öffne mehrmals ein Fenster und schaue hinaus. Der Wind, der an der Front der Häuser von Westen vorbeistreicht, trügt. Es ist, als ich vor die Tür trete, heiß und drückend. Trotzdem schreite ich aus, auf der Schattenseite den Kötnerholzweg hinunter, biege in die Velberstraße ein, überquere die belebte Limmerstraße und gehe weiter über die Leinaustraße zum Kulturzentrum Faust. Es findet auf dem Gelände allsonntäglich ein Flohmarkt statt. Einige Händler bauen schon ihre Stände ab. Meinetwegen! Ich will sowieso nichts kaufen.
In den letzten Jahren habe ich das Fährmannsfest verpasst. Direkt neben dem Faust ist der Eingang aufs Festgelände. Eine junge Ordnerin will meinen Rucksack kontrollieren. „Ich habe nur eine Plastikflasche bei mir“, sage ich und drehe ihr den Rücken zu, damit sie nachsehen kann, ohne dass ich den Rucksack abnehmen muss. Sie stellt fest, dass ich die Wahrheit gesagt habe und lässt mich durch die Sperre: „Viel Spaß!“ ruft sie mir in den Nacken, was mich total erstaunt. Ich war nicht auf die Idee gekommen, Spaß zu suchen zwischen all den Fressbuden, Kinderbelustigungen und Ständen diverser sozialer Projekte. In der Luft hängt ein Klangmatsch von den beiden Bühnen, eine Musikkonserve hier und Punkmusik von der Hauptbühne am anderen Ufer der Ihme. Ich fädele mich durch das bunte Völkchen der Lindener. An der Fußgängerbrücke wird Eintritt fürs Musikfestivalgelände erhoben.
Herr Leisetöne erzählt immer wieder gern, in einem Jahr habe es einen Stand gegeben, an dem die Leute gegen die Kommerzialisierung des Fährmannfestes protestieren konnten. Im Vertrauen habe ihm einer mitgeteilt, dass der Stand von denselben Leuten betrieben wurde, die auch für die Kommerzialisierung verantwortlich waren. Irgendwas schließt Leisetöne daraus, aber meint nicht direkt, dass „Abweichung und Dissidenz, dass Autonomie und Nonkonformität von potentiellen Störfaktoren zu Produktivkräften des Kapitalismus avanciert sind“, wie die Soziologin Silke van Dyk schreibt.

Kommerzialisierung und Protest – Fotos: Trithemius
Ich interessiere mich nicht für den Tickettpreis. Was da von der Bühne an unfertiger Musik über den Fluss tönt, lässt mich sowieso kalt. Vor drei Jahren war ich noch mit einer Frau auf dem Gelände. Damals habe ich natürlich auch nicht auf den Eintrittspreis geguckt, und die Musik war mir erst recht egal gewesen. Es hat geregnet wie Sau, wir rückten schön unter ihrem winzigen Schirm zusammen, waren trotzdem bald klatschnass, ignorierten es lange und bekamen die Idee, wie es in Woodstock gewesen sein musste, obwohl sie damals nicht einmal geboren war.
Um dem Trubel und der Sonne zu entgehen, gehe ich nach rechts am Flussufer entlang. Außerhalb des Geländes, wo die Fahrräder geparkt werden müssen, finde ich eine Bank im Schatten der Bäume und lasse mich nieder, um zu lesen. Von drüben tönt ein Soundcheck. Und einer sagt ins Mikrophon: „Ja, inzwischen bin ich eingetroffen!“ Über diese Selbstüberhebung muss ich doch schmunzeln. Nur ein begnadeter Kleingeist kann diese unerhebliche, aber offenbar für ihn selbst zuckersüße Meldung über riesige Boxen in die Welt hinaus posaunen. Es muss herrlich sein von sich zu glauben, die eigene Ankunft werde irgendwo erwartet wie die des Messias. Man braucht die spezielle Geisteskrankheit, die einen von Selbstzweifeln frei sein lässt, um die Massen begeistern zu können. Freilich tut es mir körperlich weh, wenn Anspruch und Wirklichkeit sich so gar nicht fügen wollen.
Inzwischen wundere ich mich über meine Unruhe am Vormittag. Nicht der „inzwischen eingetroffene“ Musiker, nicht die versammelten Lindener und ihre Zerstreuungen, nicht die jungen, tätowierten Frauen, die derweil die Bank neben mir besetzt haben und von Bier trinkenden jungen Männern umringt sind, nicht ihre unerheblichen Reden, nicht die Passanten, die zum Fest streben oder nach Hause trotten, nichts von allem ist so schön anregend wie meine vormittägliche Kopfreise zu Hause. Von diesem Glück vielleicht ein andermal.
Musiktipp
Selah Sue
(Live Fnac in Paris) – Raggamuffin – Crazy Vibes – Black Part Love









