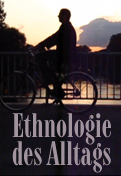 Meistens am Sonntag führt mich mein Fußweg auf den Lindener Berg. Ich kann ihn von meiner Wohnung rasch und ohne große Vorbereitung erreichen, das heißt, man kommt ohne Steigeisen hinauf. In anderen Gegenden würde man diesen nur 35 Meter hohen Hubbel nicht Berg nennen, aber es gibt in Hannover sogar einen Berggarten, der vollends flach ist und seinen Namen von einem abgetragenen Sandberg hat. Linguistisch interessant ist der Flurname „Am Lindener Berge“, mit dem Dativ-e, das die deutsche Sprache weitgehend verloren hat. Wo der Lindener Berg nicht Schrebergartenkolonie ist, überhöht „Lindener Alpen“ geheißen, erstreckt sich der Lindener Bergfriedhof, korrekt „Stadtfriedhof Am Lindener Berge“. Der Friedhof wurde 1862 eingerichtet und ist seit 1965 „außer Dienst gestellt“. Er hat einen prächtigen alten Baumbestand, in dem zahlreiche Vogelarten ihre liebe Lust haben.
Meistens am Sonntag führt mich mein Fußweg auf den Lindener Berg. Ich kann ihn von meiner Wohnung rasch und ohne große Vorbereitung erreichen, das heißt, man kommt ohne Steigeisen hinauf. In anderen Gegenden würde man diesen nur 35 Meter hohen Hubbel nicht Berg nennen, aber es gibt in Hannover sogar einen Berggarten, der vollends flach ist und seinen Namen von einem abgetragenen Sandberg hat. Linguistisch interessant ist der Flurname „Am Lindener Berge“, mit dem Dativ-e, das die deutsche Sprache weitgehend verloren hat. Wo der Lindener Berg nicht Schrebergartenkolonie ist, überhöht „Lindener Alpen“ geheißen, erstreckt sich der Lindener Bergfriedhof, korrekt „Stadtfriedhof Am Lindener Berge“. Der Friedhof wurde 1862 eingerichtet und ist seit 1965 „außer Dienst gestellt“. Er hat einen prächtigen alten Baumbestand, in dem zahlreiche Vogelarten ihre liebe Lust haben.
Da sitze ich am oberen Ende hübsch in der Sonne und hänge meinen Gedanken nach, kaum gestört von den wenigen Spaziergängern, die sich her verirren. Meist sind es junge Leute, die Alte ausführen oder per Rollstuhl über die Wege schieben. Haben sie eben im Altersheim abgeholt und zeigen ihnen jetzt, wo sie längst hingehören. Zuvor hatte ich aber die besonnte Bank von einer lesenden jungen Mutter mit Kinderwagen besetzt gefunden. Ich wollte nicht stören, war also weiter gebummelt und bald ans untere Ende gelangt, wo beim Engelsbrunnen auch eine Bank in der Sonne steht. Das Becken hat Wasser; der Brunnen plätschert aber nicht. Den Wasserspeiern am Sockel war der Saft abgedreht. Sie haben offenbar sonntags frei. Über diese gottesfürchtige Sonntagsheiligung wacht ein schwermütiger Engel. Schade, das Plätschern würde vielleicht den Lärm vom nahen Schnellweg vergessen lassen und sicher den Sonntag weniger entheiligen als diese Autofahrer. Außerdem habe ich noch nie von einem sonntäglichen Wasserspeiverbot gehört.
Das gibt Anlass und Gelegenheit ein wenig über den Lärm vom Westschnellweg nachzudenken. Wenn man alle körperhaften Farben in einen Eimer gießt, bekommt man dreckiges Braun. Ähnlich geht es mit fernem Autolärm. Egal, wer sich gerade in den stinkenden, lärmenden Wahn eingereiht hat, es ist stets die gleiche anhaltend grollende Kakophonie, aus der einzelne Autos nicht herauszuhören sind. Wer da gerade in seine Schuh und in sein Auto gesprungen ist, um auf dem Westschnellweg hinter anderen herzufahren, die wie er Heim und Herd verlassen haben, geht hier völlig unter in dem kollektiven Irrsinn mit Namen Autoverkehr. Warum muss jemand an diesem Sonntagnachmittag Verkehr sein? Hat er wichtige Dinge zu erledigen, wird er am fremden Ort dringend gebraucht? Oder fühlt er sich nur einsam und will einfach irgendwo dazu gehören und wenn es auch die reine Ohrenpest ist?
 Engelbrunnen auf dem Lindener-Berg-Friedhof – mit dem Smartphone von zwei Seiten geknipst durch Trithemius
Engelbrunnen auf dem Lindener-Berg-Friedhof – mit dem Smartphone von zwei Seiten geknipst durch Trithemius
Wie ich den Engel vor mir betrachte, der mitsamt Wasserbecken aus dem Lot gekommen ist und sich den Hang hinunter neigt, wird mir klar, dass alle sprachlichen und außersprachlichen Lebensäußerungen der Gattung Mensch wie der Lärm seiner Gerätschaften und Maschinen aus der Ferne nichts als ein gewaltiges kosmisches Rauschen sind. Hier einen individuellen Oberton zu setzen, hier durch irgendwas von Belang herauszutönen, etwa durch Wohlklang, ist schier unmöglich. Daher die zunehmend schrillen Versuche mancher Zeitgenossen, sich mit aller Gewalt Gehör zu verschaffen. Doch die spitzesten Schreie von Überdrehtheit, Lust oder Qual, sie gehen unter im Grundton der akustischen braunen Suppe, mit dem der Mensch den Kosmos verschmutzt. Wie zum Hohn haben die USA die Raumsonde Voyager I ins weite Weltall hinausgesandt mit einem Tonträger, auf dem eine Frau Edda Moser eine Arie aus der Zauberflöte trällert. Dabei weiß man andernorts längst, wie hässlich die Menschheit tönt.
Entschuldigung. Aber solche Gedanken werden aus Autolärm geboren. Es ist eine notwendige Sublimierung, solange es nicht schicklich ist, Autobahnen in die Luft zu sprengen. Schon will ich den lauten Ort verlassen, da sehe ich auf dem Plan am unteren Ausgang, dass es auch eine Friedhofskapelle gibt. Ich bin zwar schon oft da gewesen, aber die Kapelle hatte ich nie gesehen. Drum mache ich mich auf die Suche.
Die Kapelle entpuppt sich als ein schlichter neogotischer Bau. Sie ist erbaut von dem Hannoveraner Architekturprofessor „Putz ist Lüge“ Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), der in Hannover die neogotische Backsteinarchitektur verbreitet hat, despektierlich „Hasik“ genannt. Bei der Kapelle, meine ich, hätte er sich etwas mehr Mühe geben können, mehr in Hasik schwelgen dürfen. Nahebei fällt mein Blick auf einen verwitterten Grabstein: „Ruhe sanft“ steht da. Da muss ich lachen, denn just hier ist der Westschnellweg besonders laut.
Musiktipp
The War on Drugs
Red Eyes
Apropos Kampf gegen Drogen: Ich habe gehört, dass Kokain in Antwerpen sehr billig zu haben ist. Man mischt es den Brieftauben sogar ins Futter, damit sie bei Wettbewerben schneller fliegen.









