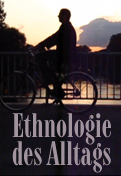 Obwohl ich kein Fotograf bin, fotografiere ich seit Jahren meinen Alltag. Doch die besten Fotos habe ich nicht gemacht, weil ich entweder den Zeitpunkt verpasst habe für einen Schnappschuss oder gar keine Kamera bei mir hatte. Einmal sah ich eine hohe Giebelwand, worin hoch oben ein einziges, kleines Fenster offen stand. Ein ziemlich dicker Mann im Feinripp-Unterhemd hatte ein Sofakissen auf den Fensterrahmen gelegt, stützte seine Unterarme darauf und schaute dreist hinaus. Es wirkte irgendwie verboten, weil ja in Brandmauern gemeinhin gar kein Fenster erlaubt ist. Auf der Bahnstrecke von Aachen nach Neuss sah ich aus dem Zug ein knallgelb gestrichenes Haus, vor dem, gut getarnt, ein gelbes Postauto stand. Beide Bilder sind mir noch vor Augen, aber ich habe sie nicht fotografieren können.
Obwohl ich kein Fotograf bin, fotografiere ich seit Jahren meinen Alltag. Doch die besten Fotos habe ich nicht gemacht, weil ich entweder den Zeitpunkt verpasst habe für einen Schnappschuss oder gar keine Kamera bei mir hatte. Einmal sah ich eine hohe Giebelwand, worin hoch oben ein einziges, kleines Fenster offen stand. Ein ziemlich dicker Mann im Feinripp-Unterhemd hatte ein Sofakissen auf den Fensterrahmen gelegt, stützte seine Unterarme darauf und schaute dreist hinaus. Es wirkte irgendwie verboten, weil ja in Brandmauern gemeinhin gar kein Fenster erlaubt ist. Auf der Bahnstrecke von Aachen nach Neuss sah ich aus dem Zug ein knallgelb gestrichenes Haus, vor dem, gut getarnt, ein gelbes Postauto stand. Beide Bilder sind mir noch vor Augen, aber ich habe sie nicht fotografieren können.
Gestern Abend bummelte ich durch mein Viertel und war zu faul gewesen, die Kamera mitzunehmen. Aber dann war ich versucht, rasch nach Hause zu gehen, um sie zu holen. Es war schon dunkel und nieselte ein wenig. Da sah ich zwei Bauarbeiter in orangefarbener Schutzkleidung. Der eine trug offenbar die Verantwortung für den anderen, der wiederum mit einem Trennschleifer eine Straßenbahnschiene durchsägte. Von Schiene und Trennschleifer stoben die Funken – als wäre jedes herausgelöste Eisenatom ein Funke, als bestünde die Schiene überhaupt nur aus eingeschlossenen Funken, die jetzt vom Trennschleifer befreit worden wären. Diesen goldenen Funkensturm hätte ich zu gerne festgehalten.
Als ich eben im Internet nachschaute, ob das Gerät tatsächlich ein Trennschleifer gewesen war, indem ich bei der Bildersuche „Trennschleifer“ eingab, bekam ich natürlich Fotos zu sehen, die genau so einen Funkensturm zeigen, nur eben meinen nicht, nicht den Funkensturm, der sich an einem nieseligen Novemberabend 2012 von den Straßenbahnschienen der Linie 9 erhoben hatte, als Arbeiter in Sicherheitskleidung eine Weiche zwischen zwei Gleiskörper bauen wollten.
Das Foto hätte ohnehin nicht gezeigt, welche Gewalt nötig ist, um eine Straßenbahnschiene zu durchtrennen. Als ich am Funkensturm vorbei ging und das angespannte Zittern in den Armen des Arbeiters sah, sah wie sich der Trennschleifer nur langsam mehr und mehr ins Metall der Schiene grub, fürchtete ich für einen Moment, das mit 13.000 Umdrehungen pro Minute rotierende Blatt des Trennschleifers könnte bei einem Verkanten zerbersten und seine Splitter wild in die Gegend katapultieren, dem Arbeiter in die blanke Stirn, oder einen Passanten mitsamt Schädeldecke skalpieren. Mit jedem Schritt der Gefahrenzone zu entrinnen, den Arbeiter aber noch immer über die kreischende Schiene gebeugt und somit in Gefahr zu sehen, das alles hätte mein Foto nicht ausdrücken können, was ich allerdings nicht beweisen kann, denn ich habe das Foto nicht gemacht. Und wir wollen ja kein Foto kritisieren, das nicht existiert.










9 Kommentare zu Von der Poesie des Trennschleifers